Eigentlich wollen wir uns am Morgen des 14. Novembers nur an einer Tasse Tee die frostigen Hände wärmen. Nichtsahnend, dass wir in dem kleinen Café im Norden Montenegros wenig später unsere Unbeschwertheit gegen Entsetzen eintauschen werden. Denn hier erreichen uns die Meldungen über die Anschläge von Paris. Und hier begegnen wir dem größten Feind dieser Reise: unserer Angst.
Angst vor der Welt. Angst vor den Menschen. Angst vor Terror, Krieg und Gewalt.
Sie macht uns misstrauisch. Lässt uns grübeln und zweifeln. Lässt uns Pläne in Frage stellen. Lässt uns die Menschen um uns herum anders ansehen.
Die Angst vernebelt unseren Blick.
Zwar meist nur für eine kurze Zeit, und manchmal auch nur für einen Augenblick. Dennoch macht sie uns wütend. Vor allem auf uns selbst. Und sie macht uns traurig. Denn Angst ist wirklich das Letzte, was wir empfinden möchten. Denn wie können wir aufgeschlossen und wissbegierig die Welt erkunden, wenn wir Angst haben, uns in ihr fortzubewegen?
Und es sind nicht nur die großen Schlagzeilen, die unsere Auffassungen ins Wanken bringen.
Seit Monaten wird unsere Reise von einem Ort zum anderen fast ausschließlich durch die Hilfsbereitschaft der Menschen, die wir treffen, ermöglicht. Während wir immer weiter gen Osten getrampt sind, wurde uns unglaublich viel Herzlichkeit und Wärme zuteil. Wohin wir auch gehen, ob in entlegene Dörfer oder geschäftige Großstädte: überall wird uns ein Lächeln geschenkt und eine helfende Hand gereicht.
Unsere eigenen Erfahrungen stehen oftmals im krassen Gegensatz zu der Welt, über die wir lesen.
Die Ängste, Zweifel und Befürchtungen, die uns packen sind meist völlig irrational. Dessen sind wir uns bewusst. Und doch: Sobald wir eine Zeitung aufschlagen oder uns Nachrichten ansehen, verschiebt sich unser Fokus. Und nicht selten klappen wir unser Tablet mit einem bitteren Geschmack im Mund zu. Denn viele von den Bildern und Texten, die wir finden, sähen Misstrauen. Misstrauen in die Welt. Misstrauen in die Menschen. Und traurigerweise, manchmal sogar Misstrauen in die nächste liebe Person, die für uns anhält.
Und es sind oftmals nicht nur unsere eigenen Ängste, die uns beschäftigen: Unsere Familien sorgen sich. Unsere Freunde sorgen sich. Neue Freunde sorgen sich. Und auch viele, die uns einen Teil des Weges mitnehmen, sorgen sich. Um unsere Route, unsere Gesundheit, ob wir genug zu essen haben und darum, dass wir im nächsten Auto womöglich an zwielichtige Gestalten geraten. Wir können das nachvollziehen. Mehr noch, wir sind dankbar, dass wir so vielen Menschen so viel bedeuten. Denn Sorge ist auch nur ein Ausdruck von Liebe. Doch an manchen Tagen füttert diese Liebe eben auch dieses mulmige Gefühl im Bauch.
Und dann wirkt jedes „Passt auf euch auf“ wie ein Vorbote einer schlechten Nachricht.
Doch wie gehen wir mit diesem mulmigen Gefühl, mit dieser Angst um? Lieber große Städte meiden? Oder Menschenansammlungen? Aufhören zu Trampen? Die Reise abbrechen?
Wozu sollte das gut sein?
An der Angst ändert sich nichts. Die können wir nur selbst auflösen. Versuchen, immer mehr darauf zu hören, was wir jeden Tag erleben und nicht, was wir tagtäglich auf dem Bildschirm lesen können. Denn eins ist klar: Angst bringt uns nicht weiter. Sie belastet uns nur. Und wir wollen keine Angst haben, wir wollen den Menschen auf unserem Weg mit offenem Herzen begegnen.
Und sicher, es werden immer mal wieder Momente kommen, in denen wir uns ohnmächtig fühlen und uns die Angst packt. Doch wir sind uns sicher, dass es uns bald immer einfacher fallen wird, damit umzugehen: Wir reisen weiter, lernen immer mehr Menschen kennen, hören ihre Geschichten. Denn wir haben Vertrauen.
Vertrauen in die Welt. Vertrauen in die Menschen. Und Vertrauen in uns selbst.
(Headerbild: Nicole Mason – unsplash.com)
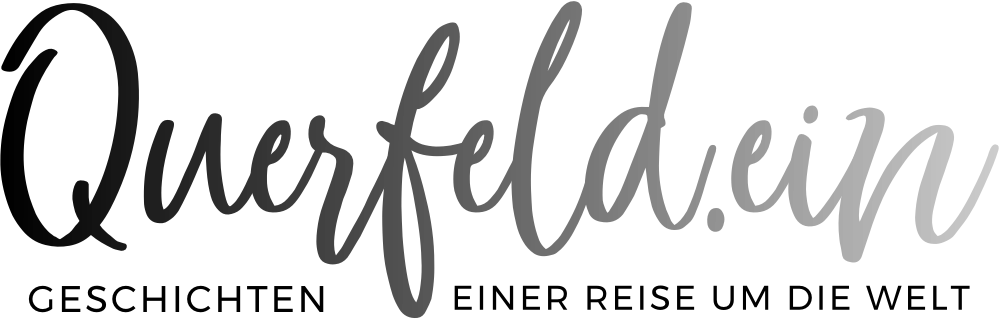




Well-expressed, Dany. Fear keeps a number of institutions in business: governments, military arms dealers, religion, you name them. Fear is the world of big business. Us small types are not so newsworthy. Love is a drag, in newspaperese. To keep alert is not a function of fear, it’s a function of readiness. Different bear. Love from here, Bud
The use of common sense is always important of course, but there is a slim line between keeping alert and being suspicious of everyone. It is difficult to keep a balance sometimes and one can lead to the other. Love, Dany